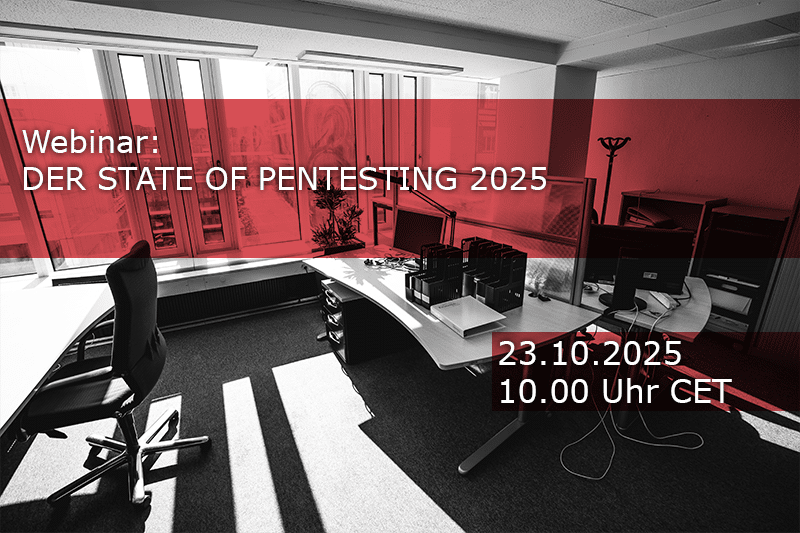Zero Trust und Privileged Access Management: Mehr Sicherheit für OT und IT
Operative Technologie (OT) galt lange als sicher, weil sie isoliert lief. Doch diese Zeiten sind vorbei. Vernetzung, Fernzugriffe und Cloud-Analysen machen heute alle Unternehmenssysteme angreifbar – von Produktionsanlagen über Finanz- und Verwaltungsprozesse bis hin zu kundenorientierten Services – und oft fehlt es an Schutzmechanismen, die in der IT schon Standard sind.
Warum OT besonders verwundbar ist
Was früher isoliert war, ist heute vernetzt. Ob Maschinen, Datenbanken oder ganze Geschäftsprozesse – Fernzugriffe und Cloud-Services schaffen Effizienz, öffnen aber auch neue Türen für Angreifende. Viele Systeme, die heute noch im Einsatz sind, wurden ursprünglich für Stabilität und eine lange Lebensdauer entwickelt, nicht aber für Cybersicherheit. Updates und Patches lassen sich in solchen Umgebungen nur schwer umsetzen, weil Ausfälle unbedingt vermieden werden müssen. Gleichzeitig setzen viele Unternehmen ihre Prioritäten nach wie vor auf Verfügbarkeit und Effizienz. Immer noch ist das Bewusstsein für Cyberrisiken in der Praxis oft gering ausgeprägt – insbesondere dort, wo Mitarbeitende nicht täglich mit IT-Sicherheit zu tun haben. All das führt dazu, dass Angreifende mit gestohlenen Zugangsdaten oder übermässigen Berechtigungen leichtes Spiel haben, um sich unbemerkt durch Systeme zu bewegen und Schaden anzurichten.